
Carmen Auer
Nachhaltige Lieferketten sind ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen. Sie tragen dazu bei, ökologische und soziale Risiken zu reduzieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen und wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Durch verantwortungsvolle Beschaffung stärken Unternehmen das Vertrauen von Kundinnen und Kunden, Investorinnen und Investoren und Partnerinnen und Partnern, senken Kosten durch effizienteren Ressourceneinsatz und verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen, die Menschenrechte und Umweltaspekte entlang der Lieferkette gezielt steuern, positionieren sich zukunftsfähig und resilient gegenüber steigenden Marktanforderungen und sich ändernden Rahmenbedingungen.
In den letzten Jahren hat sich die regulatorische Landschaft im Bereich der Lieferkette erheblich verändert. Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene wurden zahlreiche Gesetze verabschiedet,
die Unternehmen dazu verpflichten, die Bedingungen und Standards innerhalb ihrer Lieferketten zu berücksichtigen.
Diese Entwicklungen führen dazu, dass Unternehmen mit einer zunehmend komplexen und herausfordernden Gesetzeslage konfrontiert sind.
Nachfolgenden finden Sie eine umfassende Übersicht der wichtigsten nationalen und internationalen Rahmenwerke, die für Unternehmen in Deutschland von Bedeutung sind.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Strategien und Prozesse optimal auf die aktuellen regulatorischen Anforderungen auszurichten.

Wir unterstützen Sie bei der Integration sozialer und ökologischer Kriterien in der Beschaffung von Rohstoffen und Materialien. Unsere Leistungen umfassen unter anderem:
Wir unterstützen Sie menschenrechtliche Sorgfaltsprozesse effizient und effektiv in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Unsere Leistungen umfassen unter anderem:
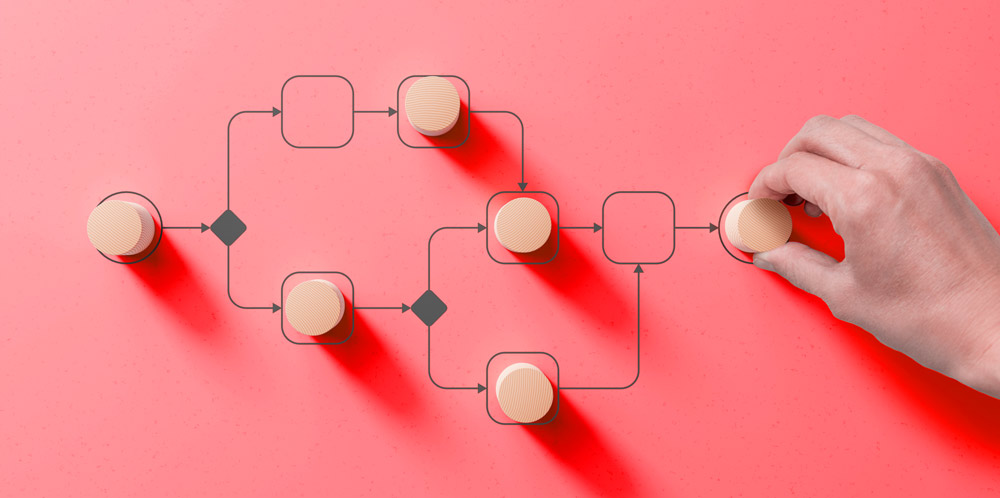

Wir unterstützen Sie dabei, Transparenz zu schaffen und ein effektives Monitoring Ihrer Lieferanten zu ermöglichen. Unsere Leistungen umfassen unter anderem:
Wir unterstützen Sie dabei, menschenrechtliche Sorgfalt strategisch in Ihrem Unternehmen zu verankern. Unsere Leistungen umfassen unter anderem:

Lassen Sie uns gemeinsam menschenrechtliche Sorgfalt im Ihrem Unternehmen und Ihrer Lieferkette verantwortungsvoll und zukunftsfähig gestalten. Sprechen Sie uns gerne an!

Carmen Auer

Carolin Diekmann

Charlotte Steinkamp